Das Fach
Das Fach Biologie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten ist ein zentraler Bestandteil des Studiums, sowohl für Lehramtsstudierende der Grundschule als auch der Sekundarstufe sowie für Studierende im Bachelorstudiengang Umweltbildung. Es behandelt wesentliche Themen, die sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft unseres Planeten von hoher Bedeutung sind.
Der Studiengang legt besonderen Wert auf praxisorientierte Lernformate und beinhaltet unter anderem einen Ökologischen Lehr-Lern-Garten sowie verschiedene Außerschulische Lernorte. Studierende erhalten eine fundierte Ausbildung, die Theorie und praktische Anwendungen miteinander verbindet.
Der Studienaufbau und die Lehrinhalte sind darauf ausgerichtet, den Studierenden ein tiefgehendes Verständnis der biologischen Zusammenhänge zu vermitteln, das sie später in verschiedenen Bildungsbereichen anwenden können.
Unsere Lehrenden & Forschenden











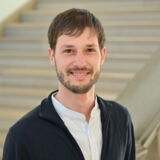

Studentische Fachschaft - StuFa Bio
Die Fachschaft Biologie an der Pädagogischen Hochschule Weingarten ist eine studentische Vertretung, die sich für die Belange der Biologie-Studierenden einsetzt und deren Interessen in verschiedenen Gremien vertritt. Sie organisiert zudem Veranstaltungen, bietet Unterstützung bei studienbezogenen Fragen und fördert den Austausch unter den Studierenden.

Unsere eigene Facebook-Seite
Die Studentische Fachschaft des Faches Biologie hat inzwischen eine eigene Facebook-Seite.
Hinweis: Mit dem Mausklick auf den Link zur "Facebook-Seite der Stufa Biologie" wird auf eine Internetseite weitergeleitet, die nicht von der PH Weingarten oder deren Lehrenden betrieben wird. Die dort publizierten Inhalte sind ausschließlich von den im Impressum genannten Personen zu verantworten. Mit dem Klick auf den nachfolgenden Link bestätige ich diesen Hinweis.

Wichtige Informationen für "Erstis"
"Erstis"
Hilfe, ich werd' nicht fertig mit Studieren:
Sollten Veranstaltungen, hauptsächlich Seminare, überbelegt sein, werden Studierende höheren Semesters bevorzugt, um deren Studienzeit nicht zu verlängern. Dies ist völlig normal. Ängste, nicht rechtzeitig fertig zu werden sind unbegründet, es ging uns allen so.
Wie, Was, Wohin soll ich mit...
Nicht verzagen, StuFa fragen! Wir bemühen uns, euch bei allen auftretenden Problemen weiter zu helfen, ihr könnt euch auf uns verlassen. Sprecht uns einfach auf dem Gang, vor oder nach einer Veranstaltung an oder schickt eine Mail mit euren Sorgen.
Tutoren
Tutoren sind meist Studenten höheren Semesters, die den Dozenten in Vorlesungen/ Seminaren zur Hand gehen, Arbeitsmaterial herrichten, selbiges wieder aufräumen, sowie Studenten bei Arbeitsaufträgen betreuen. Sie sind dafür da, euch weiter zu helfen, nutzt diese Chance!
Noch ein Wort zum Umgangston, dem Verhalten in Veranstaltungen und Schriftverkehr:
Auf den Umgangston legen wir besonders großen Wert, denn dies ist in der heutigen Zeit anscheinend nicht mehr selbstverständlich. Also denkt bitte an einen höflichen, angemessenen Umgangston – egal mit wem ihr redet.
Höflichkeit schließt auch das Verhalten in den Veranstaltungen ein. Das heißt, der Dozent beendet die Lehrveranstaltung mit einem abschließenden Wort, was heißt, dass erst dann, und ausschließlich ab dann, begonnen werden sollte, die persönlichen Schreibutensilien etc. einzupacken. Bei Seminaren, die im Gegensatz zu Vorlesungen eher praktisch angelegt sind, sollte jeder mindestens seinen Arbeitsplatz aufräumen und das ausgegebene Material zurück bringen.
Vielen mag dieser Punkt spießig oder überflüssig erscheinen, doch in der Vergangenheit hat sich mehrfach gezeigt, dass viele Studierende sich sehr unhöflich verhalten und die grundlegendsten Formen des Umgangs miteinander nicht verstanden haben.
Eine E-Mail stellt nichts anderes als einen Brief dar, also bitte auch die entsprechenden Förmlichkeiten einhalten (man fällt bei einem Brief auch nicht mit der Tür ins Haus; gängig im Schriftverkehr ist ebenso eine entsprechende Anrede und Verabschiedung).
Bei Beratungen (auch und vor allem bei E-Mails) daran denken, die Prüfungsordnung, Stufenschwerpunkt und gewählte Fachkombination anzugeben – ansonsten ist keine Beratung möglich.
Mitgliedersuche StuFa-Bio
Hast du Interesse dich zu engagieren und etwas zu bewegen? Dann melde dich direkt bei einem StuFa-Mitglied, oder per Mail. Wir freuen uns.
Studiengangs-Evaluation
Die Ergebnisse der Studiengangsevaluation stehen für alle zur Einsicht und Kommentierung bereit. Wir haben zahlreiche Maßnahmen zur weiteren Optimierung des Studienangebots abgeleitet und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen!
Weiterleitung zu moopaed (https://www.moopaed.de/)
Studium
Nachfolgend finden Sie alle Infos rund um das Studium:
- Fachinfos zum Studium
- Prüfungen
- Übersicht aller Studiengänge an der PH Weingarten
- Modulhandbücher zu den Studiengängen
- Modulverantwortlichkeiten

Fachinfos zum Studium
Info zu Studienleitfäden
Für das Fach Biologie stehen Studienleitfäden als Übersichten zur Verfügung, auf denen die besuchten Modul-Veranstaltungen eingetragen werden können. Die Übersichten sollen helfen, einen besseren Überblick über das Studium, bereits besuchte Veranstaltungen und noch ausstehende Veranstaltungen zu erhalten und damit zu einem reibungslosen Verlauf des Studiums beitragen.
LA PO 2015
Fachsprecher
Prof. Dr. Christian Hörsch
Raum: NZ 1.44
Tel.: 0751/501-8384
Fax: 0751/501-58384
Prüfungen
Zentral organisierte Prüfungen
Die zentral organisierten Prüfungen werden durch das Prüfungsamt koordiniert. Die relevanten Informationen dazu finden Sie über den Link zur Website des Prüfungsamts.
Klausuren und mündliche Prüfungen müssen beim Prüfungsamt über das LSF angemeldet werden!
Vom Fach organisierte Prüfungen
Schriftliche Modulprüfungen (Portfolios, Hausarbeiten,..) werden bei dem jeweiligen Dozenten angefragt
Klausuren und mündliche Prüfungen werden über das Prüfungsamt angemeldet (s.o.)
Bachelor- und Masterstudiengänge der PH Weingarten
Hier finden Sie alle Informationen zu den angebotenen Studiengängen der PH Weingarten. Sehen Sie sich um...

Modulhandbücher BA & MA
Hier finden Sie die gesamten Modulhandbücher zu unseren Studiengängen....

Modulverantwortlichkeiten
Sachunterricht
Module | Verantwortliche/r |
| BA Modul 1 | Markus Reiser (markus.reiser[at]ph-weingarten.de) |
| BA Modul 2 | Erziehungswissenschaften / Sachunterricht |
| BA Modul 3 | Erziehungswissenschaften / Sachunterricht |
| BA Modul 4 | Markus Reiser (markus.reiser[at]ph-weingarten.de) |
| MA Modul 1 | Prof. Dr. Christian Hörsch (christian.hoersch[at]ph-weingarten.de) |
Sekundarstufe
Module | Verantwortliche/r |
| BA Modul 1 | Prof. Dr. Holger Weitzel (weitzel[at]ph-weingarten.de) |
| BA Modul 2 | Markus Reiser (markus.reiser[at]ph-weingarten.de) |
| BA Modul 3 | Markus Reiser (markus.reiser[at]ph-weingarten.de) |
| BA Modul 4 | Prof. Dr. Holger Weitzel Dr. Lisa Kimmerle |
| BA Modul 5 | Dr. Petra Duske (petra.duske[at]ph-weingarten.de) |
| BA Modul 6 | Prof. Dr. Christian Hörsch (christian.hoersch[at]ph-weingarten.de) |
| BA Modul 7 | Prof. Dr. Christian Hörsch (christian.hoersch[at]ph-weingarten.dee) |
| MA Modul 1 | Markus Reiser (markus.reiser[at]ph-weingarten.de) |
| MA Modul 2 | Prof. Dr. Holger Weitzel (weitzel[at]ph-weingarten.de) |
Umweltbildung
Module | Verantwortliche/r |
| BA U-Bio 1 | Svenja Baumgartinger (svenja.baumgartinger[at]ph-weingarten.de) |
| BA U-Bio 2 | Svenja Baumgartinger (svenja.baumgartinger[at]ph-weingarten.de) |
| BA U-Bio/Geo 1 | Svenja Baumgartinger (svenja.baumgartinger[at]ph-weingarten.de) |
| BA U-Bio/Geo 2 | Svenja Baumgartinger (svenja.baumgartinger[at]ph-weingarten.de) |
Fachsprecher im Fach Bio
Prof. Dr. Christian Hörsch
Mail: christian.hoersch@ph-weingarten.de
Sprechstundentermine:
Do von 14:00 - 15:30 Uhr / Raum NZ 1.44
Exkursionen
Ein wesentliches Merkmal bei der Ausbildung von Biologielehrer*Innen ist die Teilnahme an Exkursionen.

Aus diesem Grund bietet das Fach Biologie nicht nur die Möglichkeit, die Region Oberschwaben und Südwürttemberg zu erkunden, sondern veranstaltet Exkursionen in ganz Deutschland und anderen Ländern. Einen Überblick der bisherigen Exkursionen im Fach Biologie finden Sie im nachfolgenden Archiv zu den Infos rund um die Exkursion...
Infos rund um unsere Exkursionen
Info
Ein wesentliches Merkmal bei der Ausbildung von Biologielehrerinnen und Biologielehrern ist die Teilnahme an Exkursionen. Aus diesem Grund bietet das Fach Biologie nicht nur die Möglichkeit, die Region Oberschwaben und Südwürttemberg zu erkunden, sondern veranstaltet Exkursionen in ganz Deutschland und anderen Ländern.
Downloads
Aktuelle Exkursion
Archiv
Exkursionsziele im SoSe 2025:
a) Wattenmeerexkursion in der Exkursionswoche
Ansprechpartner: Markus Reiser
b) Alpenexkursion an den Golm vom 06.07. - 11.07.2025
Ansprechpartnerin: Dr. Petra Duske
Download Plakat Alpenexkursion 2025Exkursion SoSe 2023: Download PP Archiv 2023
Exkursion SoSe 2021: Informationen zur Exkursion "Regionale außerschulische Lernorte Oberschwabens“(PDF)
Exkursion SoSe 2020: Informationen zur Exkursion Ebro-Delta (PDF)
Exkursion 2019: Hier kommen Sie zur Übersicht der angebotenen Exkursionen im SoSe 19 (PDF)

Herzlich Willkommen auf den Seiten des Ökologischen Lehr-Lern-Gartens (ÖLLG). Hier finden Sie Informationen zu unserem Hochschulgarten. Der Garten wird vom Fach Biologie betreut und gepflegt und ist in der Lehre der Biologie in den verschiedenen Studiengängen veranktert.
Unsere Öffnungszeiten:
Auf Anfrage: svenja.baumgartinger@ph-weingarten.de
Sehen Sie sich gerne über den nachfolgenden Link in unserem Schulgarten um:
Schulgarten- und Draußenlernen-Netzwerk Ravensburg & Region
Weiterhin vernetzen wir Schulen, Pädagog*innen, Gärtnereien, Vereine, Kommunen und Förderer, damit
Schulgärten immer weiter aufgebaut, erhalten und mehr als lebendige Lernorte genutzt werden.
Praxiswissen, Material und Unterstützung — lokal organisiert, nachhaltig gedacht.
Folgen Sie dem Link:
Forschungsprojekte im Fach Bio
Die Forschungsbereiche im Fach Bio sind aufgeteilt in folgende Arbeitsgruppen:
- AG Weitzel
- AG Hoersch
- Projektverantwortung Baumgartinger
- Projektverantwortung Aumann / Wiedemann

Per Klick auf einen der nachfolgenden Links kommen Sie zu den Projekten:
Aktuelle Publikationen
- Czok, V., & Weitzel, H. (2025). Impact of Augmented Reality and Game-Based Learning for Science Teaching: Lessons from Pre-Service Teachers. Applied Sciences, 15(5), 2844. https://doi.org/10.3390/app15052844
- Reiser, M., Binder, M., & Weitzel, H. (2025). Influence of a design-based approach in integrated STEM lessons combining biology and engineering on the intrinsic motivation of secondary school pupils. Cogent Education, 12(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2469414
- Ausgabe 501 der Zeitschrift „Unterricht Biologie“ herausgegeben von Prof. Dr. Weitzel beschäftigt sich mit der „Biologie der Geschlechter“, konkret mit der Frage, wie sich der Biologieunterricht dazu beitragen kann, die Debatte um Gender und biologischem Geschlecht zu versachlichen. In fünf Unterrichtsmodellen für die Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II wird das Thema differenziert beleuchtet (https://www.friedrich-verlag.de/friedrich-plus/sekundarstufe/biologie/unterricht-biologie/biologie-der-geschlechter-6467
Tipp: Studierende der PH Weingarten können die Zeitschrift im Rahmen des Angebotes elektronischer Zeitschriften kostenlos laden. - Diepolder, C. S., Huwer, J., & Weitzel, H. (2025). Effects of competence-based sustainable entrepreneurship education on secondary school students’ sustainable entrepreneurial intention. Sustainable Technology and Entrepreneurship, 4(2), 100103. https://doi.org/10.1016/j.stae.2025.100103
- Wiedenmann, J., Aumann, A., Weitzel, H. (2024). BioLogisch Denken: Mit KI Computational Thinking und naturwissenschaftliches Forschen verknüpfen. In J. Huwer et al. (Hrsg.) Kompetenzen für den Unterricht mit und über Künstliche Intelligenz. Perspektiven, Orientierungshilfen und Praxisbeispiele für die Lehramtsausbildung in den NaturwissenschaftenPublisher: Waxmann
Aktuelle Veranstaltungen
Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant...

Archiv Biologie
In unserem Archiv befinden sich Informationen zu vergangenen Projekten & Veranstaltungen etc. Sehen Sie sich gerne um..




